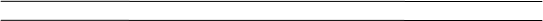Die offene Gesellschaft und ihre Zukunft
Forum am 11. Oktober 2025 in Nürnberg



© Gesellschaft für kritische Philosophie/Humanistische Akademie 2025
Programm
Ablauf
Uhrzeit Programmpunkt 13.00 Begrüßung 13.15 Einführung: Karl Poppers Konzept der „Offenen Gesellschaft“ – und einige Hinweise auf Probleme seiner praktischen Umsetzung (Dr. Frank Schulze) Schwerpunkt I: Theoretische Grundlagen und Gefährdungen der offenen Gesellschaft 13.45 Impulsvortrag: Jüngere philosophische Konzepte und ihr Gefährdungs- potenzial für die offene Gesellschaft (Prof. Dr. Wulf Kellerwessel) 14.15 Diskussionsrunde 1 - Prof. Dr. Wulf Kellerwessel (Impulsreferent) - Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber („Extremistische Denkstrukturen gegen die offene Gesellschaft – die Extremismustheorie lernt von K. Popper“) - Dr. Hans-Joachim Dahms (Poppers und Niemanns Warnung vor „Mehrheitsdiktatur“) 15.30 Kaffeepause Schwerpunkt II: Offene Gesellschaft heute (und morgen) 16.00 Impulsvortrag: Freiheit verteidigen. Wie wir den Kampf um die offene Gesellschaft gewinnen (Ralf Fücks) 16.30 Diskussionsrunde 2 - Ralf Fücks (Impulsreferent) - Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Birnbacher („Tabus in der deutschen Biopolitik”) - Frederick Herget, M.A. („Künstliche Intelligenz und offene Gesellschaft: Eine technologische Herausforderung für die Freiheit”) 17.45 Get-together (Foyer) 19.00 Ende der Veranstaltung 1) Moderation: Dr. Frank Schulze 2) Moderation: Prof. Dr. Wulf Kellerwessel & Dr. Frank Schulze Im Rahmen der Diskussionsrunden werden die Podiumsgäste jeweils ein eigenes weiteres Thema einbringen, das Sie der Klammer hinter dem jeweiligen Namen entnehmen können. Zudem besteht auch für die Teilnehmenden ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen und Diskussionsbeiträge zu äußern. Im Rahmen des Get-togethers kann bei Sekt und Häppchen weiterdiskutiert werden.Themen der Inputs
Karl Poppers Konzept der „Offenen Gesellschaft“ – und einige Hinweise auf Probleme seiner praktischen Umsetzung Dr. Frank Schulze Der Einführungsvortrag rekapituliert zunächst die Grundzüge von Poppers Konzept der „Offenen Gesellschaft“. Als Ausgangspunkte dienen die Praxisorientierung des Poppers’schen Denkens, Poppers Warnung vor den möglichen praktischen Folgen dogmatischen, essentialistischen und utopistischen Denkens sowie seine Kritik an Vorstellungen von einer weitreichenden Prognostizierbarkeit politisch-gesellschaft- licher Entwicklungen („Historizismus“). Anschließend werden Individualismus, Aufklärung, Liberalismus, negativer Utilitarismus, Herrschaftskontrolle und „Stückwerk-Sozialtechnik“ als Grundprinzipien des Popper‘schen Konzepts ausgewiesen und erläutert. Auf dieser Grundlage folgt die Reflexion einiger Probleme, die beim Versuch der praktischen Umsetzung des Konzepts auftreten können, namentlich im Zusammenhang mit negativem Utilitarismus, Herrschafts- kontrolle und kritischer Rationalität, der Stückwerk-Sozialtechnik sowie den Bindungs- und Identitätsoptionen, die eine offene Gesellschaft bieten kann. Jüngere philosophische Konzepte und ihr Gefährdungspotenzial für die offene Gesellschaft Prof. Dr. Wulf Kellerwessel Offene Gesellschaften geraten heute zunehmend unter Druck – auch durch Positionen, die in der Gegenwartsphilosophie erarbeitet werden resp. in jüngerer Zeit konzipiert wurden, nun aber breiter rezipiert werden. Diese treten auf unterschiedliche Art und Weise für geschlossene oder zumindest geschlossenere Gesellschaften ein. Der Vortrag präsentiert mehrere solcher Auffassungen, die Spielarten des Kommunitarismus, Nationalismus und Faschismus darstellen, weist auf deren (immense) Gefahrenpotenziale hin und diskutiert die angesprochenen Positionen kritisch. Freiheit verteidigen: Wie wir den Kampf um die offene Gesellschaft gewinnen Ralf Fücks Der zweite Impulsvortrag des Tages bietet zunächst eine „Phänomenologie der demokratischen Rezession“, die fünf Phänomene in den Blick nimmt: 1. Das Entstehen einer internationalen „autoritären Allianz“ (Russland, China, Iran u.a.), die sich zunehmend aggressiv gegenüber der regelbasierten „liberalen Welt- ordnung“ verhält, 2. das Scheitern des „Arabischen Frühlings“, 3. eine autoritäre Regression „elektoraler Demokratien“ (z.B. Ungarn, Türkei), 4. den Aufstieg populistischer Parteien und Politiker, 5. die Rückkehr des „starken Mannes“. Im Folgenden identifiziert der Referent kulturelle, ökonomische und politische Modernisierungsschübe als Treiber für die „antiliberale Konterrevolution“. Um dieser zu begegnen, wirbt er abschließend für eine selbstkritische Erneuerung des Liberalismus.Schwerpunktthemen der Podiumsgäste
Extremistische Denkstrukturen gegen die offene Gesellschaft. Die Extremismus- theorie lernt von Karl R. Popper Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber Armin Pfahl-Traughber wird darlegen, was die Extremismusforschung von den Theorien Karl Poppers lernen kann. Er unterstreicht, dass Popper in „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ zentrale Denkfiguren derjenigen herausgestellt hat, die geschlossene Gesellschaften propagieren. Diese wiederkehrenden Punkte (essentialistische Deutungsmonopole, deterministisches Geschichtsverständnis, kollektivistische Gesellschaftskonzeption, holistische Steuerungsabsichten und ein postulierter Traditionalismus oder Utopismus) finden im Links- wie im Rechts- extremismus sowie im islamischen Extremismus Widerhall. Bei deren Analysen lässt sich, so der Podiumsgast, an Poppers Kritischen Rationalismus fruchtbar anknüpfen. Armin Pfahl-Traughbers Kernthesen: • Gegenwärtig lässt sich in vielen Ländern eine Bedrohung für die moderne Demokratie konstatieren, wird sie doch von extremistischen Kräften unterschiedlicher ideologischer Orientierung delegitimiert und verworfen. • Der Kritische Rationalismus von Karl Popper dient in unterschiedlichem Sinne dazu, dieses Phänomen zu erkennen, wird bei diesem doch die „offene Gesellschaft“ als gesellschaftlicher Pluralismus verworfen. • Dabei lassen sich bei den extremistischen Akteuren bestimmte Denkstrukturen konstatieren: ein essentialistisches Deutungsmonopol, eine kollektivistische Gesellschaftskonzeption und eine holistische Steuerungsabsicht. Poppers und Niemanns Warnung vor „Mehrheitsdiktatur“ Dr. Hans-Joachim Dahms • Entgegen Poppers und Niemanns Warnungen vor einer „Mehrheitsdiktatur“ ist Demokratie in der Tat Volksherrschaft, allerdings in Form einer repräsentativen Volksvertretung. In modernen, größeren Staaten können direkte Demokratie und Referenden eine ständige Vertretung nicht ersetzen. • Popper und Niemanns Bevorzugung des Mehrheitswahlrechts (USA, GB) gegenüber dem Verhältniswahlrecht überzeugt nicht, u.a. weil Ersteres das Aufkommen neuer Politikangebote behindert und zu einer größeren gesellschaftlichen Spaltung in zwei unversöhnliche Lager führt. • Popper und Niemann haben ein verkürztes Verständnis von den Aufgaben von Parlament und Regierung. Ersteres wird nicht nur gewählt, um die Regierung zu kontrollieren (und ggf. abzuwählen), sondern auch und vor allem, um ein bestimmtes Programm durchzusetzen. • Popper und Niemanns Vorstellung vom Regierungshandeln in der Demokratie als schrittweise, reversible Problemlösung ist z.T. unrealistisch. Politik muss gerade in Zeiten plötzlich auftretender und gravierender Krisen auch ohne den wünschenswerten Vorlauf der Auswahl und Bewertung alternativer Handlungspfade Entscheidungen treffen, die manchmal auch nicht mehr reversibel sind. Tabus in der deutschen Biopolitik Prof. Dr. Dieter Birnbacher Medizinethische Fragen und ihre Behandlung in der deutschen Politik und Öffent- lichkeit sind das Schwerpunktthema von Prof. Dr. Dieter Birnbacher. Er erörtert bestehende Tabus im Umgang mit medizinethischen Fragen, die mit der Offenheit der bundesrepublikanischen Gesellschaft nicht kohärent zusammenpassen. In seinen kritischen Blick gelangen dabei vor allem Tabuisierungen, die menschliches Leid verursachen, existenzielle Interessen übergehen und bei besonders dringlichen Wünschen deren Realisierung verhindern. Dies betrifft Fragen der Reproduktions- medizin, Fragestellungen im Zusammenhang mit der Erzeugung von Embryonen zu Forschungszwecken und der Organtransplantation ebenso wie Wünsche, den eige- nen Tod zu bestimmen. Kritisch betrachtet wird dabei vor allem auch der politische Umgang mit den genannten Themenfeldern, der oft religiösen Überzeugungen einen hohen Stellenwert einräumt, zugleich aber versucht, Handlungsfreiräume für Betroffene offenzuhalten – was nicht selten zu problematischen Kompromissen führe, deren Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz fraglich sei. Zudem werde Intransparenz erzeugt, und den Bürgerinnen und Bürgern würden Widersprüche zugemutet, die Irrationalität begünstigten, wo Rationalität besonders dringlich sei. Dieter Birnbachers Kernthesen: • In seiner Biopolitik ist Deutschland eine allenfalls halboffene Gesellschaft. Dogmen und Tabus behindern Forschung und Praxis. • Die deutsche Biopolitik neigt dazu, nicht verallgemeinerungsfähige und ethisch nicht begründbare Tabus zugunsten von religiösen Minderheiten zu schützen. Sie effektiviert diesen Schutz mit dem „scharfen Schwert“ des Strafrechts, selbst dann, wenn er mit den Grundrechten unvereinbar ist. • Die Interessen der Geschädigten werden missachtet. Betroffenen bleibt weitgehend nur der Weg ins Ausland. Forscher sind selbst im Ausland vor Strafverfolgung nicht sicher. KI und die offene Gesellschaft: Eine technologische Herausforderung für die Freiheit Frederick Herget Frederick Herget bringt als sein Schwerpunktthema den Aspekt „Künstliche Intelligenz und offene Gesellschaft“ ein - und damit ein wegen der derzeitig rasanten Ausbreitung und beständigen Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) besonders wichtiges und weiter wichtiger werdendes. Denn die technischen Entwicklungen werden ohne Frage auch zu gesellschaftlichen Änderungen führen. Herget beschreibt Funktionsweisen und Anwendungsbereiche von KI und zeigt exemplarische, gesellschaftlich relevante Konsequenzen auf, bei- spielsweise die KI-gesteuerte Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern in China und die Schufa in Deutschland. Neben anderem thematisiert er auch politische Einflüsse und die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung sowie Vertrauens- verluste aufgrund KI-gesteuerter Fehlinformationen. Er verweist jedoch auch darauf, dass die KI selbst wiederum zur Lösung solcher Probleme beitragen kann. Frederick Hergets Kernthesen: • Technologie (insbesondere KI) hat einen Eigensinn, der in gesellschaftliche Prozesse eingreift und sie verändert. • KI ist derzeit die große halbe Unbekannte: bekannt genug, um als Sündenbock verklärt zu werden - zu unbekannt, um ihre Gefahren und ihr Potenzial richtig zu verstehen. • Der Siegeszug der KI fällt mit der säkularen Stagnation zusammen: der Phase des wirtschaftlichen Niedergangs des Westens.Tagungsort
Das Symposium findet in Nürnberg im Marmorsaal der „Nürnberger Akademie“ statt (siehe die oberen zwei Fotos links auf dieser Seite). Bei dem Gebäude handelt es sich um das ehemalige Gewerbemuseum, erbaut von 1892 von 1897 im Stil eines repräsentativen neobarocken Schlosses. Das Museum war zugleich handwerkliche und industrielle Bildungsstätte zur Vermittlung der künstlerischen Gestaltung von Gebrauchsgegenständen - heute würde man „Design“ sagen.Essen & Trinken
In der Kaffeepause (15.30 - 16.00 Uhr) wird es nicht nur Getränke, sondern auch süße und herzhafte Kleinigkeiten zu essen geben. Dies ist im Teilnahmebeitrag inbegriffen. Während des Get-togethers (17.45 - 19.00 Uhr) gibt es alkoholfreie Getränke und Knabbereien. Beides ist ebenfalls im Teilnahmebeitrag enthalten. Zudem wird Sekt angeboten. Wer vor der Veranstaltung ein Mittagessen in Nähe zum Tagungslokal einnehmen will, kann dies z.B. im Restaurant Heilig-Geist-Spital tun, das ca. 5 Gehminuten entfernt reizvoll in der Nürnberger Altstadt liegt (siehe die drei unteren Fotos links auf dieser Seite; Lageplan und Wegbeschreibung im PDF ebenda).




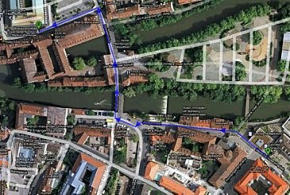
Der Weg vom Tagungslokal zum Heilig-Geist-Spital;
hier der Lageplan mit Wegbeschreibung als
PDF-Download.
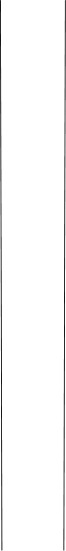
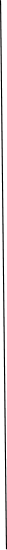
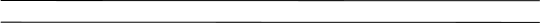
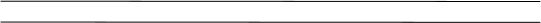









© Bettmann Archive